Sensibel über Gewalt gegen Frauen berichten, aber wie? Ein Leitfaden.
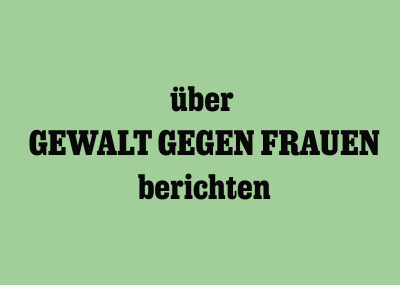
Von Sarah Neu und Mia Pankoke
Sensibel über geschlechtsspezifische Gewalt, insbesondere Gewalt gegen Frauen, zu berichten, wird im Journalismus nicht wirklich ernst genommen. Es scheint bis heute kein Qualitätsmerkmal für Redaktionen zu sein. So lautet das Fazit der Sozialwissenschaftlerin Karin Heisecke, die bis 2024 die MaLisa-Stiftung für Geschlechtergerechtigkeit in den audiovisuellen Medien und der Musikbranche leitete. Seit mehr als zehn Jahren berät sie Medien zur Darstellung von Frauen und Geschlechterstereotypen. Ein Blick in TV- und Printmedien bestätigt Heiseckes Beobachtung: So lautet die Dachzeile eines Beitrags in der „Stimme aus Heilbronn“ aus dem Frühjahr: „Mord aus Eifersucht?“ Es ging um den Prozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau mit 15 Messerstichen getötet hat. Die „Stuttgarter Zeitung“ betreibt wenig später im gleichen Fall Victim-Blaming: „Elf Jahre Haft für tödliche Stiche wegen Affäre“, heißt es da im Titel. Der „Tagesspiegel“ berichtet im Juli 2023 über einen Fall, bei dem der Täter „die Trennung nicht überwunden haben soll“ und deswegen auf seine Ex-Frau und ihren neuen Partner, seinen „Liebesrivalen“, einstach. „Bild“ und RTL schreiben im April dieses Jahres reißerisch bei einem weiteren Fall vom „Tod in der Liebeszelle“. Gemeint ist das Besuchszimmer der Justizvollzugsanstalt. Hier wurde eine Frau beim Zusammentreffen mit ihrem inhaftierten Partner von ihm getötet.
Verantwortungsbewusste Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen ist das nicht. Eine Untersuchung der Kommunikationswissenschaftlerin Christine Meltzer aus dem Jahr 2024 zeigt, dass verharmlosende Begriffe wie „Eifersuchtsdrama“ wieder häufiger genutzt werden als noch vor wenigen Jahren. In fast jedem zehnten analysierten Artikel zu Gewalt in der Partnerschaft fanden sich Begriffe wie „Drama“ oder „Tragödie“.
Gewalt gegen Frauen
Wenn in diesem Leitfaden von Gewalt gegen Frauen die Rede ist, dann, weil Frauen statistisch am häufigsten von geschlechtsspezifischer, etwa häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Diese Fokussierung benennt die strukturelle Realität patriarchaler Gewaltverhältnisse – sie bedeutet jedoch nicht, dass nur Frauen betroffen sind.
Geschlechtsspezifische Gewalt richtet sich auch gegen queere, trans*, inter* und nicht-binäre Menschen, die oft sogar besonders gefährdet sind und mehrfachdiskriminiert werden. Und auch Männer sind Opfer von Partnerschaftsgewalt. Eine verantwortungsvolle Berichterstattung sollte diese Vielfalt der Betroffenheit sichtbar machen und zugleich die strukturellen Ursachen – patriarchale, heteronormative und machtdurchdrungene Gesellschaftsordnungen – klar benennen.

Foto: Sarah Eick
Trotzdem sieht Expertin Karin Heisecke Fortschritte. Dass Medien mittlerweile häufiger über Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt berichten, sei gut. Doch das Thema adäquat abzubilden, heiße eben nicht, nur dann Sendezeit oder Zeilen freizumachen, wenn die Frau dabei brutal ums Leben kam. „Es gibt sehr viele Formen von Gewalt – Körperverletzung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die persönliche Freiheit“, sagt Heisecke. Ein Femizid, also die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Delikte gegen Frauen sind Partnerschaftsgewalt oder Sexualstraftaten. Im Jahr 2023 waren mehr als 180.000 Frauen von häuslicher Gewalt betroffen, erlebten also Gewalt innerhalb der Familie oder Partnerschaft. Bei Sexualstraftaten waren es mehr als 52 000 Frauen. Und 360 Frauen wurden bei Femiziden getötet, weil sie Frauen waren. Fast jeden Tag eine. Die Zahlen stammen aus dem Lagebericht des Bundeskriminalamts zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten. Er ist 2024 erstmals erschienen und die erste öffentliche Statistik, die Gewalt gegen Frauen in diesem Umfang untersucht. Der gefährlichste Ort für Frauen ist und bleibt ihr nächstes Umfeld, meist ihr Zuhause. Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein Problem, dessen Ursachen in der Gesellschaft zu suchen sind. Und genauso muss das Thema auch von Medien thematisiert werden: als gravierende gesellschaftliches Problem, nicht als Einzelschicksal.
Über geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen zu berichten, erfordert Sorgfalt, Sensibilität und Weitblick. Hier sind acht Wege, wie das gelingen kann.
#1 Lassen Sie Betroffene sprechen
In der Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen wird die Perspektive des Täters häufig überbetont – etwa indem Nachbarn oder Bekannte zu Wort kommen, die ihn als „netten Menschen“ beschreiben, „dem man so etwas nie zugetraut hätte“. Die Folge: Erfahrungen der Betroffenen rücken in den Hintergrund. Das führt sogar dazu, dass das Lesepublikum mehr mit dem Täter fühlt, nicht mit der Frau, die Gewalt erlebt hat. Das belegt eine Studie des Landesverbands Frauenberatung Schleswig-Holstein. Überlegen Sie sich daher genau, wessen Perspektive Sie wie viel Raum geben. Beginnen sie damit nicht erst beim Schreiben, sondern schon bei der Auswahl der Personen, die Sie interviewen. Sprechen Sie, wenn möglich, direkt mit den Betroffenen oder mit Personen, die ihnen nahestehen. Wenn das von den Betroffenen nicht gewollt ist, wenden Sie sich an Initiativen oder Verbände, die sich mit dem Thema auskennen und die Perspektive abbilden können.
#2 Führen Sie Interviews achtsam
Interviews mit Betroffenen von Gewalt gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Journalismus. Diese Gespräche verlangen Sorgfalt, klare Absprachen und echtes Zuhören. Medienschaffende müssen verhindern, dass Betroffene im Interview erneut verletzt werden. Sie tragen Verantwortung dafür, dass niemand retraumatisiert wird, dass die Würde der Betroffenen gewahrt bleibt. Retraumatisierung bedeutet, dass Personen durch Worte, die Umgebung, oder bestimmte Situationen an frühere, belastende Erfahrungen erinnert werden. So stark, dass Angst, Schmerz oder Hilflosigkeit hochkommen. Wichtig ist auch, dass Betroffene selbst bestimmen können, wie ihre Geschichte erzählt wird. Der Bundesverband Frauen gegen Gewalt (bff) weist in seinen Hinweisen für die Interviewführung ausdrücklich darauf hin, dass viele die Sorge haben, dass ihre individuellen Erfahrungen nicht beachtet werden, sondern dass das Erlebte lediglich der Illustration dient. Respekt beginnt daher schon vor der ersten Kontaktaufnahme.
Vor dem Interview: Suchen Sie Betroffene oder Angehörige für die erste Kontaktaufnahme keinesfalls zuhause, im Krankenhaus oder bei der Arbeit auf. Nehmen Sie besser über die Anwältin oder den Anwalt oder per Mail Kontakt auf. Bauen Sie dabei keinesfalls Druck auf. Es ist nie Aufgabe einer Betroffenen, in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Bevor Sie das Gespräch führen, informieren Sie sich über den Umgang mit traumatisierten Menschen, denn Fragen oder Suggestionen können erneut verletzen. Informationen gibt es etwa auf der Website des International Journalists‘ Network (ijnet) oder des Global Center for Journalism and Trauma. Die Hamburger Akademie für Publizistik bietet außerdem Seminare an. Eventuell können Sie auch Begleitung durch Beratungsstellen organisieren.
Im Interview: Klären Sie direkt zu Beginn, was öffentlich genannt werden darf. In einigen Fällen kann es nötig sein, sich selbst und die interviewte Person im Vorhinein gegen mögliche Verleumdungsklagen abzusichern. Stellen Sie keine suggestiven oder voyeuristischen Fragen, etwa: „Wie schlimm war es?“ Erzwingen Sie keine Details zu Gewalthandlungen. Lassen Sie Pausen zu, die Betroffene bestimmt das Tempo und darf und kann jederzeit abbrechen. Diese Praktiken schützen vor Retraumatisierung und wahren die Selbstbestimmung.
Die Abstimmung: Ihre Verantwortung endet nicht mit dem Interview. Betroffene müssen die Möglichkeit haben, alle Zitate mit Kontext einzusehen. Informieren Sie außerdem früh genug über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung und stehen Sie für Nachfragen zur Verfügung. Achten Sie zudem unbedingt auf alle eventuell nötigen Vorsichtsmaßnahmen, etwa indem Sie für ein möglichst sicheres Umfeld für das Gespräch sorgen und ausreichend anonymisieren. Unterschätzen Sie nicht die Gewaltbereitschaft der Täter. Die Adressen vieler Frauenhäusern sind nicht ohne Grund anonym.
Tipp: In der Journalisten-Werkstatt „Interviews sensibel führen“ erklärt Marius Elfering, wie Interviews in belasteten Situationen gelingen und Menschen sich öffnen, ohne, dass man ihnen schadet.
#3 Ein Femizid ist kein „Eifersuchtsdrama“
Vermeiden Sie Begriffe wie „Eifersuchtsdrama” oder „Liebestragödie”, wenn Sie über Gewalttaten gegen Frauen berichten. Solche Formulierungen verharmlosen das Geschehene. Die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, ist kein Drama der Gefühle, kein Streit ums Herz, sondern ein Femizid. Sprechen Sie auch so davon und nutzen Sie diesen Begriff, denn er beinhaltet die gesellschaftliche Ebene. Zudem verweist er auf das Motiv von Männern, Dominanz und Kontrolle über das Leben von Frauen auszuüben. Übernehmen Sie niemals gedankenlos Begriffe oder vermeintliche Fakten aus Polizeiberichten. Das Wort „Beziehungstat” ist dort beispielsweise ein etablierter Begriff, der sagen soll, dass sich die Personen kannten. Doch er verzerrt den Blick auf die Tat, indem er eine Nähe zwischen Tätern und Betroffenen herstellt, die Taten wie Mord, Totschlag oder Vergewaltigung verharmlosen. Sagen Sie stattdessen, in welcher konkreten Beziehung die Personen zueinanderstanden. Kannten sie sich über Bekannte? Waren sie befreundet, in einer Beziehung oder verheiratet? All das kann hinter einer „Beziehungstat” stecken. Sprechen Sie zudem von Betroffenen, statt von Opfern. Zwar ist „Opfer“ juristisch korrekt, viele empfinden die Bezeichnung aber als passiv und entmündigend.
Darüber müssen wir reden
Das „medium magazin“ 05/25 legt einen Schwerpunkt auf die Berichterstattung zur Gewalt gegen Frauen. Die Recherchen von Olivia Samnick, Antje Plaikner und Karolina Kaltschnee zur Berichterstattung über Femizide in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen, wie wichtig es ist, über Defizite in unserer Branche zu sprechen. Wenn Frauen geschlechtsspezifische Gewalt erleiden, konzentrieren sich nicht nur Boulevardmedien viel zu oft auf den Täter und verklären brutale Morde zu Einzelfällen aus „romantischen Motiven“. Dabei, und das ist eine Hoffnung, die wir mit unserem Schwerpunkt verknüpfen, kann jede und jeder Einzelne von uns in der Berichterstattung zur Gewaltprävention beitragen.
#4 Kein Victim-Blaming
Victim-Blaming – also das Beschuldigen der Opfer – gehört zu dem gravierendsten Fehlverhalten im Journalismus über Gewalt gegen Frauen. Es verschiebt Verantwortung, schützt Täter und stabilisiert patriarchale Machtstrukturen. Fragen wie „Warum blieb sie bei ihrem gewalttätigen Partner?“ oder „Hat sie ihn provoziert?“ sind keine Recherche, sondern gefährliche Schuldzuweisungen. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei den Tätern. Häufig tauchen opferbeschuldigende Formulierungen beim Versuch, die Situation anschaulich zu beschreiben auf. „Sie wollte sich trennen – das brachte ihn zur Verzweiflung“ oder „sie machte sich alleine auf den Nachhauseweg“. Solche Sätze geben Betroffenen Mitverantwortung oder romantisieren die Tat als emotionales Drama. Wichtig ist zudem, den Täter und seine Handlung aktiv zu benennen: etwa, „er griff an“ statt „sie erlitt Gewalt“ und „er tötete seine Partnerin“ statt „sie starb.“
#5 Weisen Sie auf strukturelle Probleme hin
Beschreiben Sie nicht nur den Einzelfall, sondern auch die strukturelle Dimension. Der erste Schritt ist, den Begriff Femizid zu nutzen, aber füllen Sie ihn unbedingt mit Inhalt: Wie viele Frauen sind jährlich von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen? Wie häufig werden Frauen pro Monat sexuell belästigt? Wie viele Femizide gab es im vergangenen Jahr? Gehen Sie aber auch auf andere, nicht körperliche, teils unsichtbare Dimensionen von Gewalt ein. Etwa Einschüchterung, Drohung und weitere Formen psychischer Gewalt wie Stalking und sexuelle Belästigung. Bauen Sie in jeden Text einen Absatz ein, der klar macht, dass es sich nicht um ein Einzelschicksal, sondern um ein gesellschaftliches Problem handelt. Daten und Zahlen finden Sie im jährlich erscheinenden Lagebild des Bundeskriminalamts und bei der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Auch das Europäische Parlament veröffentlicht auf seiner Website unter dem Punkt „Geschlechtergleichstellung” regelmäßig Erhebungen zum Thema.
#6 Vorsicht vor rassistischen Erzählungen!
Rechte Medien instrumentalisieren Gewalt gegen Frauen immer wieder als vermeintlichen Beweis für migrationsbezogene Gefahren. Die Strategie dahinter: Rassismus salonfähig machen. Verschiedene Fachverbände warnen ausdrücklich vor dieser Vereinnahmung. So schreibt etwa die bff in einer Stellungnahme: „Von dieser Seite wird immer wieder das Bild des ‚übergriffigen Fremden‘ bemüht, vor dem Frauen und Kinder geschützt werden müssen – anstatt anzuerkennen, dass sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt in allen Teilen der Gesellschaft ausgeübt und verschleiert werden.“ Tatsächlich gibt es keine Belege dafür, dass Gewalt gegen Frauen etwas mit Herkunft oder Kultur zu tun hat. Sie ist global und über alle Regionen, Klassen und Milieus hinweg verbreitet. Das zeigt auch ein besonders grauenhafter Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt: der Fall Pelicot. Über zehn Jahre sedierte Dominique Pelicot seine Ehefrau Gisèle Pelicot, vergewaltigte sie und ließ sie von anderen Männern vergewaltigen, während er zusah. Es waren beinahe 70 Täter. Von 20 bis 70 Jahre alt, unterschiedlicher Herkunft und aus allen sozialen Schichten. Und dies ist kein Einzelfall. Die Investigativjournalistinnen Isabell Beer und Isabel Ströh haben auf Telegram ein ganzes Netzwerk aufgedeckt, in dem Männer sich mit der Methode des Betäubens und anschließendem Vergewaltigen brüsten (das große Werkstatt-Interview mit Isabell Beer und Isabel Ströh jetzt im „medium magazin“ 05/25). Die Täter haben nur eines gemeinsam: Ihre Männlichkeit.
#7 Bildsprache

Foto: Katrin Dinkel
Bilder prägen, wie wir Gewalt gegen Frauen wahrnehmen. Allzu viele gängige Motive – die Frau mit blauem Auge, die erhobene Männerfaust – reproduzieren Hilflosigkeit. Im schlimmsten Fall wirken sie sogar retraumatisierend. Wird geschlechtsspezifische Gewalt nur mit körperlichen Taten bebildert, kann das dazu führen, dass Frauen, die psychisch unter Druck gesetzt werden, sich selbst als nicht betroffen wahrnehmen.
Es gibt Alternativen: Achtsame Bildsprache zeigt Menschen in Würde und Handlungsmacht. Bilder von Solidarität, Protest, Selbstbestimmung oder Selbstschutz. Studierende der Neuen Schule für Fotografie Berlin haben in Kooperation mit dem Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser (NbF e.V.) beispielsweise eine Fotodatenbank bereitgestellt, die häusliche Gewalt klischeebefreit thematisiert. Einige Fotos zeigen Frauen mit ihren Kindern, die in Frauenhäusern Schutz gesucht haben. Eine mögliche Bildunterschrift könnte dann sein: Eine von Gewalt betroffene Frau sucht im Frauenhaus Schutz. Andere Bilder zeigen Personen, die einander in den Armen halten. Eine Frau schaut offen und direkt in die Kamera, auf ihrem Arm stehen die Worte: „Liebe tötet nicht“.
Zeit und Sorgfalt bei der Bildrecherche lohnen sich: Sie verhindern Text-Bild-Scheren und setzen Zeichen gegen stereotype Gewaltmotive. „Gut gewählte Bilder können Betroffenen Mut machen, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen“, sagt Christine Olderdissen, Leiterin von Genderleicht und Bildermächtig. Das Projekt des Journalistinnenbundes hat einen detaillierten Leitfaden für eine bessere Bebilderung des Themas Gewalt gegen Frauen online gestellt. Darin heißt es: „Bilder, die das entschlossene Handeln gegen Gewalt zeigen, sind mächtige Werkzeuge, um positive Veränderungen zu fördern“. (Sechs Wege, wie Medienschaffende häusliche Gewalt besser bebildern können und ein Gespräch mit Christine Olderdissen zu den schlimmsten Fehlern, die Redaktionen machen, finden Sie im „medium magazin“ 05/25.)
#8 Nennen Sie Hilfsangebote
Verweisen Sie, wenn möglich, in jedem Beitrag über Gewalt gegen Frauen auf Hilfsangebote, an die sich Betroffene wenden können. Dazu zählen Beratungsstellen wie Weisser Ring und dessen „Opfer-Telefon” 116 006, Hotlines wie das Hilfetelefon 116 016 „Gewalt gegen Frauen”, die Beratungsangebote-Datenbank des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (bff) oder die Online-Suche für Frauenhäuser und Fachberatungsstellen der Frauenhauskoordinierung. Arbeiten Sie im Lokaljournalismus, listen Sie auch Hilfsstellen in Ihrer Stadt oder Region auf.
 Lesen Sie jetzt im medium magazin 05/25:
Lesen Sie jetzt im medium magazin 05/25:
Titelthema: Was nun, Herr Weimer? Der Staatsminister zeigt sich meinungsfreudig, die Branche aber erwartet Handfestes. Eine Inspektion der vier medienpolitischen Großbaustellen..
Medien und Beruf: Hidden Stars 2025. Die heimlichen Heldinnen und Helden in den Redaktionen. Klima. Best Practice aus dem Lokaljournalismus.. Stalking I. „Spiegel“-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit im Interview: „Wir müssen schneller unfreundlich werden.“? Stalking II. Wenn Journalistinnen und Journalisten ins Visier von Stalkern geraten. Über Femizide berichten. Wenn Schlagzeilen Frauenleben gefährden – obwohl Journalismus zur Gewaltprävention beitragen könnte.
Praxis: Häusliche Gewalt bebildern. Sechs Wege, wie das besser geht. Undercover im Vergewaltiger-Netzwerk. Isabel Ströh und Isabell Beer berichten von ihrer Strg_FRecherche. Toolbox. Effizienter recherchieren und schreiben. Auslandsrecherche. Wie Hanna Resch, Alexandra Berlin und Verena Hölzl sich, ihr Team und Gesprächspartner schützen.Pressereisen. Luxusreisen und Goodies sind passé. So gehen Redaktionen und Unternehmen mit Pressereisen um. Leitfaden. Sensibel über Gewalt gegen Frauen berichten, aber wie? Acht Wege.
Rubriken: Kurz & bündig und Köpfe & Karrieren. Das tut sich in der Branche. Kiosk. Diese Medien suchen Freie. Presserecht.Was dürfen Blogger? Innovationscheck. Die Kiezmische „Moazin“. Kurznachrichtendienst. Gavin Karlmeier kommentiert, was sich bei X und Co tut. Einerseits … andererseits. Sind die Medien in Deutschland zu links? Tanjev Schultz kontert Ijoma Mangold. Der reagiert. Fragebogen. Friederike Sittler: „Ich wollte den Job.“
Um Praxis geht es auch in der neuen „Journalisten-Werkstatt“ von Florian Sturm Digitale Sicherheit. Die „Werkstatt“ liegt im „medium magazin“-Abonnement gratis bei. Einzeln ist sie zudem im Shop erhältlich.
