„Die Branche ist überhitzt“
Das diagnostizieren Robin Alexander, Kristina Dunz und Stephan Lamby: Die drei Politikjournalisten des Jahres 2017 debattieren über Haltung und Wege aus dem Sog. Das Titelinterview aus unserer Februarausgabe in voller Länge (und hier in der Druckansicht).
Interview: Anne Haeming
Herr Lamby, vor knapp einem Jahr lief Ihr Film „Die nervöse Republik“ in der ARD – wie nervös ist die Branche heute?
Stephan Lamby: Sie ist in Aufruhr. Ausgerechnet der Wahlkampf war eine ruhigere Phase, jetzt ist die Branche noch hysterischer als vor einem Jahr.
Kristina Dunz: Ich finde, der Medienbetrieb ist völlig überhitzt und überdreht. Es geht nur darum, wer welche Exklusivnachricht hat. Auch wegen der sozialen Netzwerke ist viel auf dem Markt – und man muss all das toppen, um das eigene Medium im Gespräch zu halten.

Aber dieser Reflex ist doch alt.
Dunz: Aber wir müssen trotzdem weitermachen, dranbleiben, wie die Konkurrenz auch. Allerdings sollten wir neue Formate suchen, die Dauerpräsenz von Themen und Gesprächspartnern führt bei vielen Lesern zu Verdruss. Wir haben in diesem Wahlkampf vor allem gelernt, genauer hinzuhören, welche Berichterstattung den Menschen fehlt.
Verzeihung, aber genauer hinzuhören ist doch die Uraufgabe des Journalismus.
Lamby: Aber es gibt einen Strukturwandel. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Frühjahr 2016 …
… als Sie anfingen, für die „Nervöse Republik“ zu drehen …
Lamby: Genau. Da gab es das Gerücht, Sigmar Gabriel würde zurücktreten. Sehr schnell wussten alle, dass nichts dran ist. Aber sie haben trotzdem darüber berichtet. Das heißt: Niemand in den Redaktionen konnte sich erlauben, nicht auf dieses Gerücht einzusteigen. Aus einer Art vorauseilendem Gehorsam, damit die Chefredaktion nicht sagt: Wieso haben wir das nicht? Es gibt einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Alles ist extrem beschleunigt, in Zeiten von Twitter geht es um Minuten.
“Viele meinen, zum Kampagnenjournalismus gezwungen zu sein”,
Stephan Lamby, Ecomedia-TV
Diese Überdrehtheit wurde monatelang sichtbar: nächtliche TV-Bilder von Reporterpulks vor Gebäuden, mit der Botschaft: Es gibt nichts zu sagen. Macht das nicht alles noch schlimmer?
Dunz: Das war Live-Berichterstattung. Ich finde wichtig, möglichst am Ort des Geschehens die Stimmung zu erleben. Wenn Unterhändler rein- und rausgingen, konnte man sie mal zur Seite nehmen. So lässt sich der Verlauf besser nachzeichnen, als wenn man alles später nachrecherchieren müsste.
Mal ganz praktisch: Wie haben Sie die ewige Nachtarbeit durchgestanden?
Dunz: Da gibt es keine Strategie, man zieht das durch. Man fängt Dienstagmorgen an und hört Mittwochabend auf. Und mit etwas Glück kommt man ein paar Stunden ins Bett. In der Nacht zum Ende der schwarz-roten Sondierungen galt es, 36 Stunden durchzuhalten. Im Interview sagte mir ein Schlafforscher, dass Schlafentzug wie Promille wirkt – demnach waren wir alle betrunken.
Robin Alexander: Wir von der „Welt“ haben uns abgewechselt. Wenn mir jemand eine Info per SMS stecken will, ist es egal, wo ich bin. Aber ja: Bestimmte Dynamiken bekommt man nur vor Ort mit.
Der Sog schien zuletzt sogar so stark, dass Anne Will keine Talkshowrunde zusammenbekommt, einige Politiker und auch Journalisten wie Bernd Ulrich bei Twitter kundtaten, erst mal die Klappe zu halten.
Lamby: Auch ich hatte ein paar Tage lang Schwierigkeiten, Interviewtermine zu bekommen, das habe ich so noch nicht erlebt. Das lag an der Unsicherheit während des SPD-Mitgliederentscheids. Aber schnell war alles wieder wie vorher. Bei einigen Politikern hielt die Stille keine 24 Stunden: Katarina Barley etwa twitterte am 12. Februar, sie werde sich eine Weile zurückhalten – schon am nächsten Tag kommentierte sie auf Twitter wieder die SPD-Entwicklung.
Herr Alexander, haben Sie das Gefühl, dass Sie sich da raushalten können?
Alexander: Ich als Person schon, um auch einmal abzuschalten. Wir als „Welt“ nicht. Wollen wir auch gar nicht: Wir wollen dabei sein und wir wollen schnell sein.
Dunz: Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so viel auf dem Markt, dass die Menschen abschalten. Das Ansehen von Journalisten hat sich weiter verschlechtert, viele verstehen nicht mehr, dass Informationen Unabhängigkeit bedeuten.Und dass ich diese Informationen brauche, auch um wählen zu können.
Wie nehmen Sie diese Kluft wahr?
Lamby: Die amerikanischen Kollegen haben während des US-Wahlkampfs über Monate ausführlich geschrieben, was für ein Typ Donald Trump ist, die britischen Kollegen legten detailliert dar, welche Folgen der Brexit haben wird, wir haben intensiv über die AfD berichtet. Wozu hat das geführt? Wir haben Trump, wir haben den Brexit und wir haben die AfD in nahezu allen deutschen Parlamenten.
Alexander: Manche Milieus scheinen resistent gegen Enthüllungen. Als die „Welt“ wenige Tage vor der Wahl E-Mails von Alice Weidel hatte, die ihr Weltbild enttarnen, dachten sowohl wir als auch die AfD, dies hätte dramatische Auswirkungen auf deren Wahlergebnis. Aber es hat der AfD überhaupt nicht geschadet, dass ihre vermeintlich liberale Vorzeigefrau in Wirklichkeit völkisch denkt.
Lamby: Ein großer Teil unserer Leser und Zuschauer hat sich von uns entfremdet. Das Ergebnis ist niederschmetternd.
Eine Erklärung für diese Entfremdung ist, dass sich große Teile der potenziellen Zielgruppe von der Berichterstattung nicht repräsentiert fühlen.
Alexander: Wenn es so ist, wären daran die Journalisten schuld, nicht die Leser.
Dunz: Dann berichten wir wieder zu viel. Und wenn wir nicht berichten, heißt es: Lügenpresse. Es ist schwierig.

Die Unterhaltung über die sogenannte Kluft führen wir seit mindestens drei Jahren. Was waren Ihre Gegenstrategien?
Alexander: Da bin ich klassisch: Wenn ich als Journalist nicht verstanden werde, habe ich einen Fehler gemacht, nicht der Leser. Ich will nicht kategorisch klingen, aber aus der Nummer hilft uns keiner raus: Verständlichkeit ist die Bringschuld des Reporters.
Ist Verständlichkeit das einzige Problem?
Lamby: Viele Journalisten trennen nicht klar genug zwischen Bericht und Meinung. Da ist was dran. Deswegen mache ich auch verstärkt Filme ohne Kommentartext, oder mit sehr zurückhaltendem Text, lasse Bilder und O-Töne sprechen. Die „Bild“-Zeitung ist stolz auf ihren Kampagnenjournalismus, aber man findet ihn auch in der Qualitätspresse. Dieser Entwicklung müssen wir uns stellen und eine Genrediskussion führen.
Alexander: Die Otto Brenner Stiftung hat die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise analysiert – demzufolge haben wir einen Bias gehabt. Oder nehmen wir das Phänomen Schulz: Der Kollege Hans-Martin Tillack hat das Mitte Februar dankenswerterweise im „Stern“ aufgearbeitet: Zuerst bekam der Mann nur Vorschusslorbeeren, jetzt jagen wir ihn wie einen Trottel durchs Dorf. Wir als Journalisten sind diesem Mann nicht gerecht geworden.
Aber was folgt daraus?
Alexander: Keine Euphorie zu pumpen für Schulz oder für Merkel. Sondern ruhig zu berichten, was die Person politisch erreicht hat und was nicht.
Sie diagnostizierten unserer Branche nun Sog und Rudeljournalismus: Das sind keine neuen Phänomene. Aber wie ließe sich diese Struktur durchbrechen?
Lamby: Es ist ganz schwer, dagegen zu steuern – es ist Teil des Strukturwandels. Alle Versuche, zu entschleunigen und zu versachlichen, haben es schwer, weil der ökonomische Druck enorm stark ist. Streit verkauft sich besser als Nachricht. Oder wie mir „Bild“-Chef Julian Reichelt im Interview bestätigte: „Dinge, über die Menschen sich streiten, funktionieren in der Reichweite besser als Dinge, über die Menschen sich einig sind.“ Viele meinen daher, zum Kampagnenjournalismus gezwungen zu sein.
Das klingt nach Kapitulation.
Lamby: Man kann feststellen, dass Kampagnenjournalismus kommerziell gesehen eine Realität ist, und sich trotzdem wünschen, dass andere Haltungen sichtbar werden. Uns stehen ja alle Mediengattungen zur Verfügung. Wenn man gegen den Strom schwimmt, kann man ja auch Aufmerksamkeit erzeugen.
Alexander: Um mit Hegel zu sprechen: Jedes Ding geht mit seinem Gegenteil schwanger. Wenn Lambys These stimmt und die Kampagne und der Meinungsjournalismus verkaufen sich im digitalen Zeitalter besser, entsteht auf der anderen Seite ein großes Bedürfnis nach puristischer Recherche und Einordnung – und kommentarlosen Filmen.
“Manche Milieus sind resistent gegen Enthüllungen“,
Robin Alexander, “Welt”
Die zwei Strömungen sieht man an den „Longreads“ auf der einen Seite und dem „Snackable Content“ auf der anderen. Haben die Tageszeitungen da verloren?
Dunz: Nein, haben sie nicht. Wir gehen auch in die Richtung, längere Strecken zu bringen. Aber ich glaube, auch die vielen kleineren Stücke über ein und dasselbe Thema sind wichtig. Man kann nicht bei wichtigen politischen Entwicklungen fünf Wochen oder Monate schweigen und dann nur eine große Geschichte bringen.
Lamby: Wir ergänzen uns: Sie machen die Tagesberichterstattung und ich halte so lange die Füße still und bringe dann ein, zwei Mal im Jahr eine große Geschichte. Robin Alexander hat sogar ein Buch geschrieben („Die Getriebenen“, Anm. d. Red.). Er hat sich Zeit genommen, jenseits der Twitter-Schnelligkeit. Davon wünschte ich mir mehr: Beiträge, die über den Tag hinaus gültig sind. In meiner Branche gab es für diese politischen Reportagen lange das Schimpfwort „Chefredakteursfernsehen“. Aber mein Film „Bimbes“ über die schwarzen Kassen von Helmut Kohl , der im Dezember um 22:45 Uhr lief, hatte einen höheren Marktanteil als der Lebensmittelcheck von Tim Mälzer um 20:15 Uhr. Wir müssen uns fragen: Unterschätzen wir das Publikum? Ich wünsche mir mehr Mut zur Relevanz.
Dunz: Ich glaube, es gibt unter den Lesern und Zuschauern eine Sehnsucht danach, Informationen in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Auch ich hätte gerne oft mehr Zeit zum Recherchieren, einen Tag mal nichts schreiben zu müssen und dann einen langen durchdachten Text. Dafür bräuchte man aber mehr Leute und das ist nicht zu bezahlen. Und so müssen wir manchmal den Mangel verwalten. Die „Rheinische Post“ steuert dagegen: Meine Stelle wurde zusätzlich geschaffen, jetzt sind wir fünf im Berliner Korrespondentenbüro.
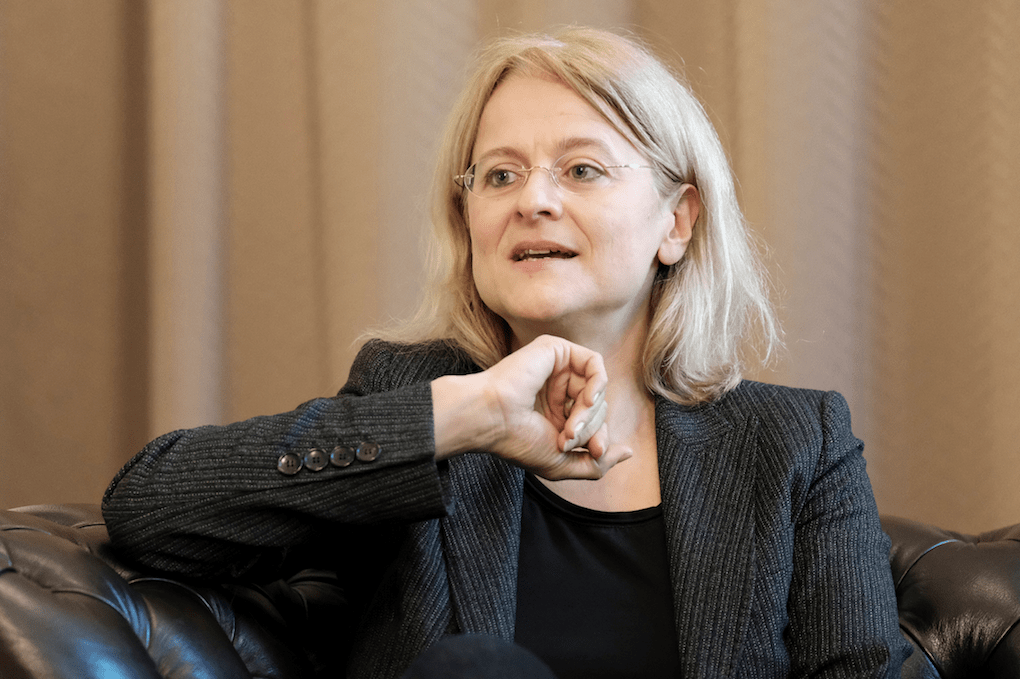
Frau Dunz, Sie waren bis Herbst bei der dpa, sind das Schnelle gewohnt. Welchen Ausweg sehen Sie noch?
Dunz: Gerade weil ich 25 Jahre bei der Nachrichtenagentur war, ärgert mich immer wieder, wenn sensationsheischend oder ohne jeglichen nachrichtlichen Wert berichtet wird. Es müsste ein medienübergreifendes Agreement über Verhaltensregeln geben.
Zum Beispiel?
Dunz: Ich würde mir eine Übereinkunft über ethische Regeln wünschen. Wir müssen auch respektvoll mit Menschen umgehen, die in die Kritik geraten – man denke auch an die Berichterstattung über Christian Wulff und das Bobby-Car. Aber eine Einigung auf ethische Regeln ist unrealistisch, die Medien sind zu unterschiedlich.
Auch der Wettkampf um die Nachricht wird das verhindern.
Lamby: Ich glaube auch nicht, dass ein Agreement funktionieren würde. Aber wir sind nicht nur Getriebene, sondern selbst Akteure. Wir müssen ja nicht alle in dieselbe Richtung rennen. Ich freue mich immer, wenn sich jemand dem Rudel in den Weg stellt – mit guten Argumenten. Das passiert in unserer Branche zu wenig.
Diesen neuen Meinungsjournalismus befeuert, dass viele Journalisten bei Social Media präsent sind.
Lamby: Viele schreiben ja noch dazu: „private Meinung“ – ein seltsames Signal. Sie geben damit all jenen Futter, die uns misstrauen: als ob sie in ihrem Medium nicht das publizieren dürften, was sie wirklich denken.
Mit Blick auf den Vertrauensverlust – der laut einer neuen Studie der Uni Mainz wieder abgenommen hat – scheinen diese Social-Media-Präsenzen positiv, weil viele einer Person eher trauen als einem System. Doch zugleich gibt es Momente, die die journalistische Objektivität infrage stellen, etwa wenn ARD-Kollegin Tina Hassel begeistert vom Grünen-Parteitag twittert. Wie stehen Sie zu dem Dilemma?
Lamby: Ich finde es erst mal eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass Journalisten mit ihrem Gesicht und ihrem Namen für das einstehen, was sie veröffentlichen. Man muss sich im Nachhinein an den Kopf fassen, dass es beim „Spiegel“ so lange gedauert hat, bis sie sich getraut haben, ihre Namen unter den Artikeln zu veröffentlichen.
Frau Dunz, Sie halten sich bei Twitter zurück. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Dunz: Mir ist der Druck zu hoch, ich überlege genau, welche Meinung ich dort äußere. Für mich ist es ein Instrument, um zu zeigen, dass wir nah dran sind, etwa wenn ich von einer Nacht während der Sondierungsgespräche twittere. Aber stimmt, meine eigenen Texte verbreite ich nicht, ich mag diese Selbstbeweihräucherung nicht.
Dabei geht die Entwicklung hin zum Journalisten als Marke. Wie gehen Sie mit Selbstvermarktung um, Herr Alexander?
Alexander: Wir bei der „Welt“ versuchen durchzusetzen, dass für Qualitätsjournalismus im Netz gezahlt wird. Das ist unsere Mission. Wenn ich einen Text bei Twitter mit einem Knopfdruck an 13.000 Leser schicken kann, wäre ich doch verrückt, wenn ich das nicht täte. Dazu gehört, dass man auf den Kanälen authentisch ist, auch als Person.
Ein Argument für Social Media ist Transparenz, als Teil des „Meta-Journalismus“, wie Stephan Detjen vom Deutschlandfunk es formuliert, um unsere eigene Arbeitsweise sichtbar zu machen. Wie bei „Spiegel“ oder „Zeit“ zu sehen, mit „Glaskasten“-Blog, Veranstaltungen, Texten, die klarmachen: Das wissen wir, das nicht. Was halten Sie von dem Ansatz?
Alexander: Das kann man machen, aber ich glaube, man erreicht damit nur ein sehr spezielles Publikum. Generell gilt: Die Leute wollen vor allem, dass unsere Fakten stimmen. Wie wir daran gekommen sind, interessiert sie weniger.
Dunz: Meiner Meinung nach geht es eher darum, nahbarer für die Bürger zu sein. Anders als bei der Nachrichtenagentur bekomme ich nun Leserbriefe, über die ich mich sehr freue, auch wenn sie schlimm sind. Wenn eine Telefonnummer dabei steht, rufe ich an. Außer wenn mir gewünscht wird, dass ich von Syrern vergewaltigt werde. Dann gibt es eine klärende Zeile per Mail.

Worüber unterhalten Sie sich?
Dunz: Ich gehe auf die Kritik ein, manchmal muss ich einräumen, dass mein Hintergrundwissen nicht sichtbar wurde. Das ist aber häufig ein Platzproblem.
Lamby: Es ist gut, dass wir nun in direktem Kontakt mit unseren Lesern und Zuschauern stehen. Schon Bertolt Brecht forderte in seiner Radiotheorie in den 1920ern, den Distributionsapparat Rundfunk in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Wir Fernsehjournalisten haben bis vor einigen Jahren den Erfolg von Sendungen fast ausschließlich an ihrer Quote messen können. Morgens um 8:30 Uhr klopften wir uns auf die Schulter oder weinten ins Taschentuch. Das war das einzige Feedback, das ist doch absurd. Trotz der Hassmails: Unterm Strich bringen uns soziale Medien weiter.
Alexander: Neu ist, dass über die digitalen Medien eine Gegenöffentlichkeit entstanden ist. Das hat es hier einmal vorher gegeben – und das war bei der Gründung der taz in den späten 1970er-Jahren. Da gab es Menschen, die sagten: In eurer Berichterstattung kommen die neuen sozialen Bewegungen nicht vor, wir finden uns bei euch nicht wieder. Daraus entstand der Tunix-Kongress, Stadtteilzeitungen und die taz. Die Öffentlichkeit hat sich auch jetzt wieder erweitert: Auf Facebook, Twitter, Blogs tauschen sich Menschen jenseits unserer Medien aus, mit anderen Themen, einer anderen Tonlage.
Lamby: Was jetzt in den sozialen Medien passiert, ist mir erst mal sehr sympathisch. Weil es Menschen die Möglichkeit zu Teilhabe gibt, wie früher bei den Piratensendern. Es ist eine Bewegung, die der Demokratie Sauerstoff zuführt. Trotz der Gefahr, dass diese gigantische Maschine missbraucht wird, wie wir das im amerikanischen Wahlkampf gesehen haben.
„Es müsste ein medienübergreifendes Agreement über Verhaltensregeln geben“,
Kristina Dunz, “Rheinische Post”
Weil Politiker ungefiltert kommunizieren können. Nach Trump hat das nun auch die AfD entdeckt und angekündigt, einen eigenen „Newsroom“ zu gründen, als wären sie Red Bull. Wie gehen Sie damit um?
Dunz: Wenn man nur den Newsroom der AfD – oder einer anderen Partei – nutzt, ist das AfD pur, ohne Analyse. Unabhängige Berichterstattung in Deutschland ist so selbstverständlich, dass viele sie nicht mehr als Wert erkennen. In diesem Internet gibt es ja fast alles kostenlos, vielen reichen Überschrift und Teaser.
Lamby: Wenn Trump mit seinen zig Millionen Followern kommuniziert, die AfD einen eigenen Newsroom einrichtet, die Politiker einen direkten Kontakt zu den Wählern suchen, dann ist der Subtext: Wir erzählen euch die Wahrheit, die die Journalisten euch vorenthalten. Sahra Wagenknecht erzählte mir für „Die nervöse Republik“: „Wenn ich über Facebook eine Million Menschen erreiche, ist das wie eine mittlere Zeitung, ohne dass mich jemand filtert.“ Uns Journalisten ist es bislang nicht ausreichend gelungen, Lesern, Zuschauern, Usern zu vermitteln, worin unsere Leistung besteht. Wenn wir Informationen weglassen, bedeutet das ja auch, dass wir etwas hinzufügen: Wir zensieren nicht, sondern ordnen ein und gewichten.
Inwiefern tragen Sie als Journalisten Mitverantwortung für politische Stabilität?
Dunz: Klar müssen wir durch unabhängige, kritisch-distanzierte Berichterstattung dafür sorgen, dass dieses beste System aller Systeme auf der Welt dem Anspruch an die Pressefreiheit gerecht wird.
Alexander: Wir Journalisten nehmen unsere Verantwortung doch ernst, oft sogar ernster als die Politiker. Ein Beispiel: Als ich mein Buch über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung veröffentlichte, fragte mich der Fernsehsender Russia Today mehrmals für ein Interview an. Das habe ich immer abgelehnt. Denn ich berichte kritisch über unsere Regierung, aber nicht in einem Medium, das von einer anderen Regierung bezahlt wird, um unsere Demokratie zu erschüttern. Ironischerweise hat die Bundesregierung selbst diese Skrupel nicht. Der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel gab im Wahlkampf Russia Today gerne Interviews.
Lamby: Ich weiß nicht, ob ich da für alle drei sprechen kann. Aber wir dürfen uns diese Frage gar nicht stellen. Wir können ja nicht Informationen zurückhalten, weil sie möglicherweise dem System schaden. So dürfen wir nicht ticken.
Die AfD ist jetzt Oppositionsführer im Bundestag, traditionell eine herausgehobene Position, auch für die Berichterstattung. Wie sollten die Medien damit umgehen? Gegnerschaft wagen, wie „Spiegel“-Kollege Georg Diez vorschlägt?
Alexander: Nichts wäre falscher! Unsere Rolle ist die eines neutralen Berichterstatters. Wir müssen über die AfD genauso kritisch schreiben wie über die CDU oder die Grünen, nicht mehr, nicht weniger.
Lamby: Informieren und aufklären. Das ist unser Job, auch bei der AfD.
Dunz: Wir müssen die AfD immer und immer wieder inhaltlich stellen. Wenn sie Mist erzählt, und das ist ziemlich häufig, es widerlegen, einordnen, kritisieren. So wie bei allen anderen auch.
Und was ist mit Themengewichtung? In einem Frauke-Petry-Porträt in der „New York Times“ merkte der Autor an, mit Blick auf die deutschen Medien wirke es, als sei Petry Regierungschefin – und in der „Nervösen Republik“ heißt es ebenfalls, die Berichterstattung tue so, als sei die AfD eine 40-Prozent-Partei. Wie sieht es da mit der journalistischen Verantwortung aus?
Lamby: Natürlich können Kollegen selbstkritisch anmerken, diese Partei hochgejazzt zu haben. Aber ich habe auch Verständnis für die Berichterstattung in der Anfangsphase der AfD. Als die Partei neu war, hat sie Neugier geweckt, eine urjournalistische Reaktion. Ich habe verstanden, weshalb AfD-Politiker in Talkshows eingeladen werden. Man wollte sie halt kennenlernen.

Aber immer nur zu einem Thema.
Lamby: Das ist ein anderer, sehr berechtigter Vorwurf. Aber dass sie als neues Phänomen Futter für die Journalisten waren, ist doch klar.
Dunz: Zuerst hieß es, wir würden sie verschweigen – um diesen Vorwurf zu relativieren, berichteten die Medien in den letzten Wahlkampfwochen mehr, meiner Meinung nach zu viel. Es war eine wichtige Gruppe, ja – aber immer noch eine außerparlamentarische Gruppe.
Die es dennoch geschafft hat, dass die öffentliche Debatte fast nur ums Flüchtlingsthema kreiste.
Alexander: Es gab sehr offene Kritik aus dem Umfeld der Kanzlerin, dass die Kollegen beim TV-Kanzlerduell überhaupt zum Thema Flüchtlinge gefragt hätten. Man hatte sich gewünscht, dass die letzten drei Monate vor der Wahl überhaupt nicht darüber berichtet wird. Gott sei Dank haben sich die Kollegen nicht daran gehalten!
Dunz: Dass aber die Kollegen fast nur thematisierten, was in allen Medien zwei Jahre lang aufgearbeitet wurde, fand ich fahrlässig und unjournalistisch. 60 von 90 Minuten wurde nur über Flüchtlingspolitik geredet und wenig nach vorne geschaut – etwa auf die Digitalisierung. Das Thema wird uns voll auf die Füße fallen.
Alexander: Unsere Verantwortung ist, die Fragen zu stellen, die die Leute beschäftigen, das ist unser Job, fertig.
Dunz: Wir merken das Dilemma an den Klickzahlen: Online werden Beiträge über die AfD viel besser geklickt als manche über Merkel. Was sollen wir da tun? Noch kann ich sagen: Wir haben ja eine tolle Zeitung.
Alexander: Also bei der „Welt“ läuft Berichterstattung über Merkel super, gerade im Netz!
“Der Medienbetrieb ist überhitzt. Es geht nur darum, wer welche Exklusivnachricht hat”,
Kristina Dunz, “Rheinische Post”
Noch etwas hat die Präsenz von AfD und Pegida beeinflusst: das Vokabular der öffentlichen Debatte. Wie hat sich Ihr Umgang mit Sprache verändert?
Alexander: Wir haben mittlerweile eine Kultur im öffentlichen Diskurs, nicht nur im Journalismus, der Regelverstöße sucht, als seien wir in der Tanzstunde. Ich gebe ein Beispiel: Die ZDF-Sportreporterin Katrin Müller-Hohenstein sagte in der Halbzeitpause eines Fußballspiels, ein Tor von Miroslav Klose müsse für ihn wie ein „innerer Reichsparteitag“ sein. Daraufhin bricht ein Twitter-Shitstorm los. Jemand vom Öffentlich-Rechtlichen entschuldigte sich, statt sich vor seine extremistischer Neigungen völlig unverdächtige Mitarbeiterin zu stellen. Das ist doch absurd!
Das ist acht Jahre her. Was ist mit Begriffen wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom etc.?
Dunz: Ich habe schon relativ früh versucht, Begriffe wie diese zu vermeiden.
Lamby: Es gibt eine Sensibilisierung, eine gewisse Achtung im Umgang mit Sprache.
Alexander: Weil wir verlernt haben, den Diskurs mit Argumenten zu führen, führen wir ihn mit Triggerpoints. Wenn wir über Flüchtlinge schreiben, bekommen wir Briefe von rechts und von links. Von rechts kommt: Das heißt nicht Flüchtlinge, sondern Migranten! Von links kommt: Das heißt nicht Flüchtlinge, sondern Geflüchtete! Das ist doch absurd, alle wissen, wovon die Rede ist. Wir sind doch unter Erwachsenen! Dass Journalisten politisch-korrekte Haltungsnoten verteilen, nervt Leser und Zuschauer unendlich!
„Political Correctness“ als Kampfbegriff wird dem Komplex nicht gerecht.
Alexander: Danke für die Haltungsnote! Das ist exakt, was ich meine! Spaß beiseite: Unsere amerikanischen Kollegen haben nun wirklich Erfahrung mit Political Correctness – und jetzt heißt ihr Präsident Donald Trump! Das bringt also alles gar nichts. Aber um jetzt mal den resignativen Unterton aus diesem Gespräch rauszukriegen: Ich glaube, Journalismus wird ungemütlicher werden und …
Lamby: Das ist jetzt der Versuch, den Ton zu ändern? (alle drei lachen)
Alexander: … aber: Es wird sehr viel interessanter werden. Wir stehen vor super Zeiten im politischen Journalismus, wir werden wieder echte Debatten bekommen. Meinungsäußerungen bringen uns nicht weiter, die kann jeder im Netz selber machen. Und das Mikrofon für Politiker halten, das macht das Bundespresseamt mittlerweile schön ausgeleuchtet selber. Wir können nur noch mit eigenen Stoffen, eigenen Zugängen, eigener intellektueller Durchdringung punkten. Das wird anstrengender, aber auch viel spannender.
Lamby: Und gleichzeitig gibt es Heerscharen von freien Journalisten, die am Rande des Prekariats vegetieren …
Dunz: Ich mache den Beruf seit 30 Jahren, ich fand ihn immer nervenzerfetzend spannend – gelangweilt habe ich mich nie.
Lamby: Auch wenn es inhaltlich spannender wird: Die wirtschaftliche Grundlage vieler Kollegen droht wegzubrechen. Das wird sich auswirken auf die Ausbildung, auf die Recherchezeit. Noch immer fehlen neue, erfolgreiche Geschäftsmodelle. Das muss man so hart formulieren. Aber wir sollten auch nicht fatalistisch sein. Wie Robin Alexander sagte: Jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Wir müssen die Mechanismen erkennen und für uns nutzen. Dieser Verantwortung soll sich jeder Einzelne stellen.
DIE PERSONEN
Die drei Politikjournalisten des Jahres 2017
„Welt“-Redakteur Robin Alexander, der politische Filmemacher Stephan Lamby und die „Rheinische Post“-Korrespondentin Kristina Dunz sind die Top 3 der Politikjournalisten des Jahres 2017. Das Gespräch mit den dreien direkt nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen war geprägt von dem Tempo, das die Reporter während der vergangenen Monate erlebt hatten, als sich Tweets und Leaks aus den nächtlichen Runden häufig überschlugen.
In der Jurybegründung über Robin Alexander, der bei der taz volontierte und seit 2008 für die „Welt“ berichtet, heißt es, er sei ein „engagierter und reflektierender Hauptstadtjournalist“, „lustig, klug und erstaunlich ideologiefrei“. Sein Buch „Die Getriebenen“ offenbare einen „einzigartigen Blick in den Maschinenraum der Politik und ist mit die beste investigative Recherche des Jahres“.
Gleich drei wichtige Politikreportagen lieferte der mit Preisen überhäufte Stephan Lamby mit seiner Produktionsfirma Ecomedia TV im vergangenen Jahr der ARD. Neben dem „Bimbes“-Film im Dezember über Helmut Kohls schwarze Kassen setzte er mit den präzisen Dokus „Nervöse Republik – ein Jahr Deutschland“ und „Das Duell Merkel gegen Schulz“ „noch mehr als sonst aufsehenerregende Akzente in der politischen TV-Berichterstattung“, befand die Jury. Den Deutschen Fernsehpreis für „Nervöse Republik“ als beste Doku bekam er 2018 auch. Mit Erscheinen von mm 02/2018 strahlte die ARD seine Reportage über die Regierungsbildung „Im Labyrinth der Macht“ aus.
Kristina Dunz arbeitete seit 1991 bei der dpa und wechselte im Herbst 2017 zur „Rheinischen Post“ als stellvertretende Leiterin des Berliner Büros (Leitung: Eva Quadbeck). Im März 2017 machte sie international Furore mit ihren Fragen an US-Präsident Trump („Warum macht Ihnen Pressevielfalt eigentlich so große Angst …?“). Die Jury der „Journalisten des Jahres“ lobt Dunz für „ihre kritischen Fragen an den US-Präsidenten“ und stellt fest: „Diese Offenheit zeigte sie aber keineswegs nur im Weißen Haus, sie brillierte in diesem Wahlkampfjahr auch mit einer Vielzahl politischer Beiträge und Analysen.“ Im Oktober 2018 erscheint ihr Buch über Annegret Kramp-Karrenbauer (zusammen mit Eva Quadbeck).

Das Titelinterview erschien in „medium magazin“ 02/2018. Das ganze Heft gibt es hier.
Alle Fotos: © Wolfgang Borrs